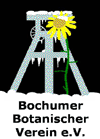Exkursion in die Eifel 07.06.2012-10.06.2012 - NSG Dachsbusch Einleitung / NSG Dachsbusch / Laacher See / Wingertsbergwand & Basaltsteinbruch Ahl / Spitznack & Loreley am Mittelrhein / Dauner Maare / Mosenberg, Wolfsschlucht / Hatzenport im Moseltal / Dreimühlener Wasserfall / Wacholderheide Hönselberg
Der Dachsbusch zwischen Wehr und Glees, nahe dem Laacher See gelegen, wurde vom Bochumer Botanischen Verein bereits im Jahr 2009 aufgesucht. Ausführlichere Infos hierzu sowie weitere Pflanzen finden Sie hier .
Wehrer Kessel Die komplexe Entstehung dieses Kessels steht vermutlich im Zusammenhang mit der Eruption gewaltiger Massen von Asche und Bims (sog. Hüttenberg-Tuff) vor etwas über 200.000 Jahren und dem darauf folgenden Einbruch der Geländeoberfläche über dem entleerten vulkanischen Herd. Schmincke, H.-U. 2009: Vulkane der Eifel. Aufbau, Entstehung und heutige Bedeutung. - Heidelberg: Spektrum (© T. Kasielke)
Die markanten Hangmulden südöstlich des Dachsbusch wurden unmittelbar nach der Ablagerung des Gleeser Bims vor etwa 150.000 Jahren ausgespült (© T. Kasielke)
© C. Buch
© C. Buch
© C. Buch
Auf den Wiesen oberhalb des Steinbruchs
Nickendes Leimkraut (Silene nutans ) ... (© T. Kasielke)
... betrachtet Menschen (© C. Buch)
© C. Buch
Flügelginster ... (© T. Kasielke)
... Genista sagittalis (© T. Kasielke)
Prachtvoll bis protzig: die Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum ) ... (© T. Kasielke)
... hier und da mit Pilzbefall (© T. Kasielke)
Gewöhnliches Kreuzblümchen (Polygala vulgaris , © C. Buch)
Sonnenröschen (Helianthemum nummularium , © T. Kasielke)
Zierliches Labkraut ... (© C. Buch)
... Galium pumilum (© T. Kasielke)
Die weltberühmte "Rutschfalte", die geomorphologisch korrekt eine Solifluktionsfalte ist.
© T. Kasielke
© T. Kasielke
Die Gesteinsfalte entstand während der vorletzten Eiszeit (Saale-Glazial). Damals war der Boden des Dachsbusch ständig bis in mehrere Meter Tiefe gefroren. Nur die obersten 1-2 m tauten zeitweilig auf. Dieser wassergesättigte Auftauboden rutschte langsam als breiartige Masse hangabwärts (Solifluktion). Hierdurch wurden die ursprünglich hangparallel abgelagerten Aschen verschleppt und umgebogen. Der Bereich der Umbiegung markiert die Grenze zwischen Auftauboden und Permafrost (Permafrosttafel). Die oberflächennahen Schichten tauten häufiger auf als die tieferliegenden Bereiche des Auftaubodens, weshalb sie schneller abwärts wanderten als die tieferen Schichten. Später, aber noch während der Saale-Eiszeit, wurde der Dachsbusch von Löss überweht, der als dünnes helles Band über den rötlichen Aschen erkennbar ist. In ihm sind einige größere Basaltblöcke und -steine eingebettet, die vom Gipfel des Dachsbusch durch den Prozess der Solifluktion mit dem Lössbrei hangabwärts gewandert sind. Schließlich erfolgten vor etwa 150.000 Jahren dann am Ostrand des Weherer Kessels Bimstuff-Ausbrüche, die den ganzen Dachsbusch-Vulkan überschütteten. Durch diese als "Gleeser Bims" bezeichneten Ablagerungen wurden die Rutschfalte und der überlagernde Löss vor Abtragung geschützt (© T. Kasielke).
© I. Vogler
© A. Jagel
Im Steinbruch
Beim Dachsbusch handelt es sich wie bei den meisten Vulkanen der Eifel um einen Schlackenvulkan (© T. Kasielke)
Deutlich zu erkennen ist die Wechsellagerung aus rötlichen Wurfschlacken und fest verschweißten alkalibasaltischen Schlacken (Schweißschlacken). Diese werden von rötlichen Aschen überdeckt, die ebenfalls dem Dachsbusch-Vulkan entstammen und in denen sich die "Ruschfalte" ausgebildet hat (© T. Kasielke)
Zierliche Felsen-Fetthenne ... (© T. Kasielke)
... Sedum reflexum (© T. Kasielke)
Triften-Knäuel (Scleranthus polycarpos , © T. Kasielke)
Ein auffälliges Moos: ... (© A. Jagel)
... die Graue Zackenmütze ... (© A. Jagel)
... Racomitrium canescens (© A. Jagel)
© S. Wiggen
© C. Buch
Weiter geht's ...
Ansprechpartner: Till Kasielke, Armin Jagel